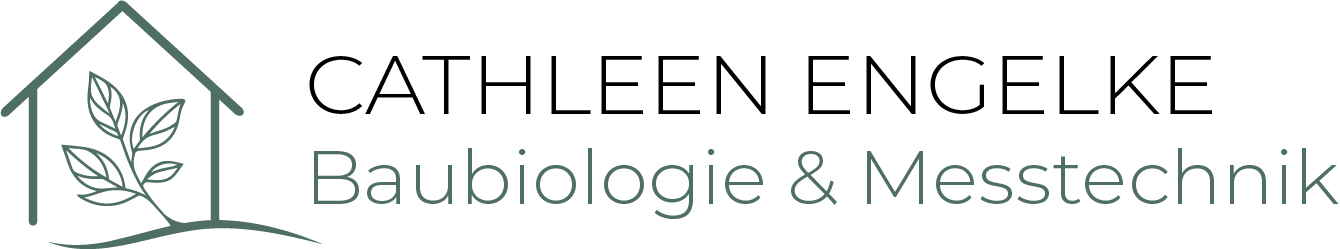Es gibt Substanzen, die sieht man nicht und doch haben sie eine enorme Wirkung auf unser Wohlbefinden. Formaldehyd ist genau so ein Fall. Ein gasförmiger Stoff, der oft unbemerkt in der Raumluft schwebt und über viele Jahre hinweg gesundheitlich belastend sein kann. Als Baubiologin stoße ich bei meiner Arbeit regelmäßig auf diesen versteckten Mitbewohner – besonders in Räumen, in denen Menschen über Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Reizsymptome klagen, ohne dafür eine Erklärung zu haben.
Was genau ist Formaldehyd?
Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0) ist ein farbloses Gas mit einem stechenden, leicht süßlichen Geruch. Es gehört chemisch zu den Aldehyden und wird seit Jahrzehnten als Grundstoff in der Industrie eingesetzt – unter anderem für die Herstellung von Klebstoffen, Harzen und Kunststoffen. Besonders verbreitet ist Formaldehyd in sogenannten Harnstoffharzen (UF), Phenolharzen (PF) oder Melaminharzen (MF), die in vielen Holzwerkstoffen als Bindemittel verwendet werden.
Das Problem: Diese Stoffe gasen mit der Zeit aus, besonders unter Wärme oder hoher Luftfeuchtigkeit. Dabei wird das Formaldehyd in die Raumluft abgegeben. Je nach Material, Verarbeitung und Alter kann das über Jahre hinweg geschehen.
Wo begegnet uns Formaldehyd im Alltag?
Die Verwendung von Formaldehyd ist vielfältig und die Belastung durch Formaldehyd entsteht nicht durch ein einzelnes Produkt sondern oft durch das Zusammenspiel vieler kleiner Quellen im Wohnumfeld. Häufig findet man den Stoff in:
- Möbeln aus Pressspan, OSB oder MDF
- Laminat- und Fertigböden
- Wandfarben, Lacken und Klebstoffen
- Bügel- oder knitterfreien Textilien
- Reinigungsmitteln und Desinfektionssprays
- Zigarettenrauch
Während Massivholzmöbel in der Regel kein Formaldehyd freisetzen, können beschichtete oder verleimte Holzwerkstoffe – besonders solche mit UF-Harz – überdurchschnittlich hohe Emissionen verursachen. Selbst neue, hochwertig aussehende Möbel können Formaldehyd enthalten.

Woran erkenne ich Formaldehyd? Geruch und Symptome
Der typische Formaldehyd-Geruch wird oft als scharf, stechend oder beißend beschrieben. Manche Menschen empfinden ihn als „chemisch“, andere merken ihn kaum. Das hängt stark von der individuellen Empfindlichkeit ab.
Noch wichtiger als der Geruch sind jedoch mögliche Formaldehyd-Symptome. Bereits in geringen Konzentrationen kann Formaldehyd die Schleimhäute reizen. Häufige Beschwerden sind:
- Brennende oder tränende Augen
- Kratzen im Hals, Hustenreiz
- Kopfschmerzen und Müdigkeit
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Reizungen der Haut
- Allergische Reaktionen
Langfristig kann Formaldehyd giftig wirken. Die WHO und das IARC stufen es als „wahrscheinlich krebserregend“ ein (Gruppe 1). In höheren Konzentrationen wird es mit Atemwegserkrankungen, Asthma und Hautekzemen in Verbindung gebracht.
Wie misst man Formaldehyd zuverlässig?
Wer vermutet, dass Formaldehyd die Ursache für Beschwerden sein könnte, braucht Klarheit. Eine baubiologische Messung bringt genau das: belastbare Daten.
Die Messung erfolgt mit einem speziellen Luftprobenahmegerät, das die Raumluft über ein chemisches Filtermedium ansaugt. Dieses Medium reagiert mit eventuell vorhandenem Formaldehyd und speichert es, sodass die Probe anschließend im Labor analysiert werden kann. Dort wird die Konzentration des Gases präzise bestimmt – meist mithilfe der HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatografie).
Damit das Ergebnis aussagekräftig ist, gibt es vor der Messung einige wichtige Regeln: Fenster sollten mindestens 24 Stunden vorher geschlossen bleiben, auf das Verwenden von Reinigungsmitteln oder Duftkerzen wird am Messtag verzichtet, und das Messgerät wird in Aufenthaltsbereichen auf Atemhöhe platziert. Nur so entsteht ein realistisches Bild der tatsächlichen Belastung.
Je nach Raumgröße und Fragestellung kann zusätzlich eine Kurzzeitmessung mit Sofortergebnis oder eine Langzeitmessung über mehrere Stunden sinnvoll sein.
Was kannst du tun, wenn die Belastung erhöht ist?
Auch wenn das Wort „Formaldehyd“ erst einmal beunruhigend klingt: Du bist dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt eine Reihe wirksamer Möglichkeiten, um die Belastung zu reduzieren oder sogar vollständig zu beseitigen.
Manchmal ist es bereits ausreichend, neue Möbel gründlich auslüften zu lassen – am besten in einem separaten, gut belüfteten Raum. In anderen Fällen lohnt es sich, besonders belastete Materialien zu identifizieren und gezielt auszutauschen. Holzwerkstoffe mit hohen Emissionen können durch zertifizierte, emissionsarme Alternativen ersetzt werden. Zusätzlich können Abdichtungen an Kanten oder Rückwänden helfen, das Ausgasen zu reduzieren.
Fazit: Gesundheit beginnt in der Luft
Formaldehyd ist giftig – aber nicht unausweichlich. Wenn du in deinem Zuhause Symptome verspürst, die du dir nicht erklären kannst, lohnt sich ein Blick auf die Raumluft. Gerade deshalb ist es so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – nicht aus Angst, sondern aus Bewusstsein.